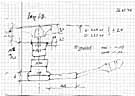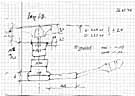Selbstbau - Tonarm "The Unswayed"
Allgemeines
- Oktober 2007 überarbeitete Version -
Bevor man den Entschluss fasst, es sich anzutun einen Tonarm selber bauen zu wollen (und "es sich antun" ist hierfür genau der richtige Ausdruck), sollte man sich vorab ein wenig schlau um die Materie machen.

Auf diesem Bild noch eine grafische Spielerei - im weiteren Bericht ein entscheidendes Bauteil
Wer sich im Netz auch ein wenig aufschlauen möchte, dem kann ich hierzu folgende Links empfehlen:
Eine ziemlich vollständige Liste der am Markt erhältlichen Arme mit entsprechenden Herstellerlinks unter Audiotools - Tonearms
Technische Spezifikationen dieser Arme in der The Vinyl Engine - Tonearm Database. Zudem findet man unter der "Library" viele interessante Artikel zum Download.
Neben vielen interessanten Artikeln gibts es in der Kategorie Enjoy the Music - Freestuff für den Einsteiger einige kostenlose Einstellhilfen zum Download. Dem engagierten Vinylhörer würde ich trotzdem zu einer richtigen Justagelehre raten. Unter Einstellschablone - Feickert stelle ich eine der Besten vor. Unbedingt downloaden sollten man sich die kleine Excel-Datei nach Bärwald und Löfgren. Mit Hilfe dieser lassen sich anschaulich die Abhängigkeit der Fehlstellwinkel und Abtastverzerrungen von der effektiven Tonarmelänge und der Justage der Nulldurchgänge darstellen. Denn nur an zwei Punkten - eben den Nullpunkten - auf der Platte steht der Tonabnehmer gerade in der Rille. Die restliche Zeit muss man sich bei Abtastung durch einen Radialtonarm neben der Musik auch Geometrie-bedingte, mehr oder minder starke Verzerrungen anhören. Tangetialtonarme haben dieses Problem freilich nicht, benötigen aber die aufwendigere tagentiale Lagerung. Und ein reibungsarmes Lager ist ein neuralgischer Punkt eines jeden Tonarms wie wir im weiteren sehen werden.
Audiotic ist eine der vielen Seiten mit einem kleinen Online-Rechner zur Bestimmung der Resonanzfrequenz der Paarung von Tonabnehmer und Tonarm. Zudem ist das kleine Förmelchen offengelegt und es werden schlüssige Erklärung zur Einhaltung des 8-12 Hz Bereichs gegeben.
Allgemeine Informationen zur Schallplattenproduktion und Schallplattenwiedergabe gibt es auf dieser Seite von FL-Electronic.
Letztlich ist ein Radialtonarm für nichts anderes verantwortlich als möglichst reibungsfrei, allein durch die Führungskraft des in der Vinylrille laufenden Diamanten bewegt, den Tonabnehmer ein paar Gradwinkel über die Platte zu schwenken. Dieser doch sehr simple mechanische Aufbau soll also nur den sündteueren Highendarmen gelingen? Für einige tausend Euro erhält man am wiederauflebenden Analogmarkt etliche Kreationen bestehend aus einem oder mindestens zwei Lagern (einpunkt- oder kardanisch gelagert) und ein paar Gramm bearbeites Metall, Holz, Acryl oder ähnlichem. Grob lässt sich der Aufbau in folgende Baugruppen aufteilen:
Headshell - halbzöllige Anschraubpunkte für den Tonabnehmer
Tonarmrohr - erzeugt u.a. die effektive Länge vom Lager zur Headshell
Lager - ein kardanisches Lager oder Einpunktlager (meist eine Stahlspitze auf einer Platte oder eine Edelsteinkugel in einem Teller)
Antiskating - ein fadenumgelenktes Gewicht, Federkraft oder sich gegenüberstehende Magnete bringen auf den Tonarm die notwendige Gegenkraft zur Skatingkraft auf, mit der dieser durch den Abtastvorgang zum Platteninneren gezogen wird. Die Abtastkräfte auf die beiden Flanken der Rille (rechter und linker Kanal) bleiben so nahezu im Gleichgewicht und die Stereodarstellung korrekt sowie Verzerrungen bei laut ausgesteuerten Platten gering.
Gehäuse - Befestigungsmöglichkeiten zur Anbringung des Tonarms an einen Tonarmausleger oder die Basis einen Plattenspielers
Vorgeschichte
Eigentlich fing alles wieder ganz harmlos an: Der bei meinem Transrotor mitgelieferte Rega RB300 spielte trotz Tweaking und besserer Verkabelung nicht auf einem Niveau, dass die Vinylwiedergabe deutlich gegenüber dem überragend (analog-)lebendigem CD-Spieler Gamut CD3 gewann. Zudem war der Betrieb eines höherwertigen Tonabnehmer wie dem Ortofon Valencia nicht zufriedenstellend. Selbst wenn diese Paarung zueinander passen würden, wäre doch ein Highend-Tonabnehmer an einem - in seiner Preisklasse sehr guten - RB300 wie ein Ferrari-Motor in einem Fiat. Das Potenzial könnte man also nie ausreizen.
Bereit um die 1000 EUR für ein hochwertiges Fertigprodukt auszugeben suchte ich den Martk ab. Interessante Produkte schien es bei SME, Nottingham, Jelco (deutscher Vertrieb unter Phonotools), Morsiani, Scheu oder Kuzma zu geben. Leider waren Vorführmöglichkeiten bei den meisten Händlern Mangelware und das Ausleihen von Tonarmen zum heimischen Check der Sinnhaftigkeit der Anschaffung unmöglich. Wohl nicht ganz unverständlich, da es sich um empfindeliche feinmechanische Bauteile handelt, die schnell Schaden nehmen oder verschliessen werden könnten. Die Suche nach weiteren interessanten Produkte, wie beispielsweise luftgelagerte Tangential-Arme oder dem Well Tempered Tonearm habe ich mir dann gänzlich erspart. So blieb immer der Zweifel, ob sich ein entsprechendes Upgrade überhaupt lohnen würde bzw. ob man überhaupt den passenden Spielpartner für sein Laufwerk und diverse potenzielle Tonabnehmer auswählen würde.
Richtig gute Tonarme, wie ich sie beispielsweise auf der Messe Analog Forum 2005 hören konnte, werden zudem zu Kursen weit oberhalb der angepeilten 1000 EUR angeboten. So würde mir ein Schröder Reference von Schröder Tonarme beispielsweise sehr gut gefallen. Der hat ein scheinbar simples aber geniales (dazu später mehr) Lager , in vielen erdenklichen Ausführungen lieferbar und klingt anerkanntermassen in nahezu jeder Konstellation sehr gut. "Aber über 4000 (!) EUR für ein an einem Faden hängendes Holzrohr - ist das nicht ein bischen übertrieben?"
Das weit mehr dahinter steckt, als ein Holzrohr an irgendeinen Faden zu hängen; der Teufel auch hier konstruktiv im Detail steckt und selbst der Aufwand für ein DIY-Tonarm mit Schröderlager sowohl kommerziell als auch vom Arbeitsaufwand ganz erheblich ist, sollte sich im weiteren Verlauf meines Projektes zeigen.
Ein Lichtblick zeigte sich aber schnell am Horizont. Pardon, im Internet: Der Schröder Patentarm ist wohl der am häufigsten kopierte Tonarm, zu dem es viele hilfreiche Informationen in einschlägigen Foren gibt. Nicht selten gibt Frank Schröder selber immer wieder Tipps, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge zu seinen legal (der Aufbau für den Hausgebrauch und ohne kommerzielle Absicht) geklonten Armen ab. Meine ehrlich gemeinte Anerkennung für soviel uneigennütziges highfideles Engagement - denn DIY´ler und Schröder-Käufer dürften wohl nur eine sehr kleine Schnittmenge bilden.
Frank über Frank
Warum klont der geneigte Selbstbauer einen Schröder-Tonarm und nicht andere hochwertige Produkte? Erst einmal: Weil es so simpel ist - oder zumindest auf den ersten Blick scheint! Aufwendige kardanische-gelagerte Tonarme wie beispielsweise einen Tri-Planar lassen sich wohl so leicht nachbauen wie ein Schweizer Chronograph. Für einen Schröder-Klon sind nicht Präzisionslager zu beschaffen bzw. beim Uhrmacher vorgespannte Rubinlager in Auftrag zu geben. Das Lager besteht lediglich aus einem sich tordierenden Faden, an dem das Tonarmrohr samt Gegengewicht hängt. Der Tonarm wird zusätzlich über sich gegenüberstehende Neodym-Magnete in Position gehalten. Diese Magnete bedämpfen zudem durch den Abtastvorgang eingestreute Schwingungen. Genial einfach - einfach genial.
Dieses Lager ist deshalb so aussergewöhnlich, weil es die unvermeidliche Lagerreibung und Stick-Slip-Effekte (bei nur kleinen Bewegungen tendiert nahezu jede Materialpaarung sich nicht gleichmässig in Bewegung zu setzen, sondern zu haften und dann ruckartig loszubrechen) auf ein absolutes Minimum reduziert. Diese Effekte sind nämlich auch bei gehärteten Stahlspitzen oder Rudinkugeln in Keramikpfannen vorhanden. Zwar nur minimal, aber wir sprechen schliesslich auch nur von minimalen Bewegungen und hochempfindlichen Tonabnehmern. Ein sich verdrillendes unelastisches Multifilament mit einem Knoten als Lagerpunkt scheint zwar auf den ersten Blick ein wenig archaisch, ist aber praktisch frei von oben genannten Effekten. Ein weiterer praktischer Nutzen bietet die simple aber effektive Antiskating-Funktion durch die Vor-Verdrillung des Multifilaments. Die so eingebrachte Torsionskraft ist die Antiskatingkraft. Funktioniert prima, ganz ohne die üblichen Magnete, Federn oder Gewichte.
Trotzdem sind die Tonarme von Frank Schröder nur Insiderkreisen bekannt und es gibt wenige offizielle Testberichte. Einzig die Tests von Hifi & Records und TNT-Audio sind mir bekannt. In den Foren diyaudio und dem Analog-Forum kann man allerdings einiges über diese Arme erfahren und erhält zudem unter dem Suchwort "Schroeder Clone" etliche Berichte (meist sehr zufriedener) Selbstbauer, die das Konzept von Frank Schröder verwendet haben.
Besonders hervorzuheben sind die privaten DIY-Seiten von Michael Methe, Christian "Krishu" und die wertvollen Ausführungen zum Schröder-Klon von Michael "MiWi" (mit etwas Glück im Analog-Forum zu finden).
Wer ein wenig duch Netz surft findet neben der Patentschift von Frank Schröder (beispielsweise auf der Seite des Europäischen Patentamtes - aus Respekt vor Frank Schröders Idee nun zum Selbersuchen ohne direkten Link zur Patentschrift), auch diverse Manuals der Tonarme, die detaillierte Aufstellungs- und Justageanleitungen der Original-Tonarme liefern. Der erfolgreiche Nachbau zu privaten Zwecken scheint einem leicht gemacht zu werden.
Wer sich nun mit Hilfe des Netzes alle notwenigen Unterlagen zusammengesucht hat und über die entsprechenden Fertigungsanlagen verfügt (Zugang zu einer tauglichen Fräs- und Drehmaschine sollte man schon haben), sollte nun fast eine identische Kopie - also den Klon - erzeugen können!? So einfach ist es nun leider doch wieder nicht. Ich habe mich über ein Jahr mit der Materie beschäftigt und dabei ordnerweise Unterlagen gesammelt, Skizzen gezeichnet und Berechnungen angestellt, und musste dabei feststellen, dass der Teufel wieder einmal im Detail steckt. Hierzu mehr auf den nächsten Seiten unter Konstruktion und Aufbau. Hinsichtlich einiger Eigenschaften des Originals wird der Selbstbauer wohl nie das Original erreichen. Und ich meine hiermit nicht die geheimnisvolle mehrfache Beschichtung der Holzrohre oder den Material-Mix der Tonarmbasis aus unterschiedlichen Metallen oder Hölzern. Diesbezüglich kann der engagierte Selbstbauer sicher selber mit diversen Ölen, Wachsen, Lacken und eigenen Material-Mischungen sehr gute Ergebnisse erzielen - und vor allem selber experimentieren und eigene Erkenntnisse sammeln. Mir sind bei der Websuche höchst unterschiedliche Original-Schröder-Kreationen untergekommen. Für den Selbstbauer gilt hier Studieren und Probieren! Was waren aber nun die unerreichbaren Eigenschaften?
Hier schweigt sich Frank Schröder selbst natürlich weitgehend aus. Recht hat er, lebt er doch vom Verkauf der Toarme und nicht vom Foren-Posting an Kopierer. Mal sehen was ein Selbstbauer hier erreichen kann...
Fest steht, dass es schwierig werden würde einen D=10x5 mm Neodym-Magneten für die Fadendurchführung zu durchbohren ohne die magnetischen Eigenschaften zu veränderen. So muss bei der DIY-Version das Knötchen des Lagerfadens oberhalb der Magnetscheibe am Tonarm verbleiben, während es beim Original innerhalb des Magneten liegen kann. Im weiteren sind alle festen Verbindungen beim Schröder-Tonarm Presspassungen, während der Selbstbauer beispielsweise seine Magnetscheiben einkleben muss. Mit diesen Einschränkungen sollte ein hochwertiges Ergebnis allerdings kaum eingeschränkt werden. So baute meines Wissens nach Frank Schröder selber frühe Versionen mit oben liegenden Lagerknoten - auf die Auswirkungen werde ich an geeigenter Stelle zu sprechen kommen - und bei Verwendung moderner Klebstoffe sind zudem kaum schlechtere Verbindungseigenschaften zu erwarten. Tatsächlich verwendet man im modernen Maschinenbau immer häufger Hochleistungsklebeverbindungen die hinsichtlich Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und auch vermeintlichen audiophilen Resonanz-Einflüssen anderen Verbindungsarten mindestens ebenbürdig sind.
Alle Zweifel ausgeräumt? Also los!
Checkliste
Noch kurz die wichtigsten Prämissen und Links für den Selbstbau notieren:
Lager nach Schröder-Patent Schröder Tonarme
Geeignete Neodym-Zylinder möglichst hoher Magentfeldstärke besorgen. Preisgünstig und gut beispielsweise unter Magnetladen.
Austauschbare Armrohre zwischen Lager und Headshell vorhalten. So kann später nicht nur für jeden Tonabnehmer das passende Rohr eingesetzt werden, sondern auch mit verschiedenen Materialien und unterschiedlichen effektiven Tonarmlägen experimentiert werden, um das klangliche Optimum zu finden. Für Tonarmrohre aus Holz benötigt man einen versierten und verständnisvollen Schreiner und viel Geduld und Zeit bei der Behandlung des Holzröhrchen mit Wachsen und/oder Lacken, damit Resonanzen bedämpft werden und sich die Eigenschaften des Armes mit der Zeit nicht mehr verändern können. Carbon-Rohre erhält man beispielsweise beim Carbon-Team oder beim Carbon-Vertrieb.
Ergänzung 04/2008: Von überraschend vielen Nachbauwilligen werde ich immer wieder nach Bezugsquellen für Aramidfasern gefragt. Da meine eigene Bezugsquelle versiegt ist, hier nun Bezugsquellen, die mir von einem netten Leser genannt wurden: Lange+Ritter GmbH und Schwarzwälder Textilwerke.
Keinen Schröder-Klon bauen.
Moment mal, KEINEN Schröder-Klon!?
Der schlichte Nachbau des Schröder-Designs ist doch ein bischen langweilig und einfallslos. Frank Schröder selber weist immer wieder in seinen Forumsbeiträgen darauf hin: Warum nur Kopieren, wenn man eigene Ideen einbringen kann? Das reduziert nicht nur die Gefahr, dass das Bild einer schlechten Kopie im Netz dem Renomme des Originals schaden könnte, sondern trifft auch den Kern der Selbstbau-Idee: Die Schaffung eines Unikats nach eigenen Vorstellungen.
Ich muss zugeben, dass auch meine erste Skizzen das (sehr hübsche) Design der Schröder-Tonarme aufgriffen. Aber der Wunsch die Parameter zu optimieren auf die man als Selbstbauer Einfluss nehmen kann, und der Ausspruch eines befreundeten Konstrukteurs (ohne audiophile Verblendung) bei Prüfung meiner ersten Skizzen: "Warum muss das so ein windiges Klötzchen-Design sein? Und warum muss das Gehäuse zu einer Seite offen sein? Ihr Highender macht doch sonst alles resonanzoptimiert!?"
Ja, warum eigentlich? Über Antworten oder Ideen an meine email würde ich mich freuen.
Mein Design sollte demnach resonanzoptimiert sein und hierfür ein geschlossenes Profil als Gehäusebasis besitzen.
Anmerkungen nach Frank Schröder September 2007:
Bezüglich des offenen Profils des Lagerbocks merkt Frank Schröder an, dass er selber auch mit geschlossenen Profilen experimentiert hat. Sowohl messtechnisch als auch akustisch hat sich bei seinen Armen allerdings die von ihm verwendete Form als die günstigere erwiesen.
Interessanterweise gibt es mittlerweile auch ein kommerzielles Lizenzprodukt des Schröder Tonarms von Nordic Concept (s.a. Messebericht High End 2007 - WLM), das ähnlich meinem DIY-Tonarm auch ein geschlossenes Profil verwendet.
Erste Skizzen
Schnell war unter obigen Vorgaben eine erste Skizze erstellt (Bild 1).

Das Drehteil mit Durchbruch sieht erst einmal wenig nach Tonarm aus, aber hier wird schon klar welche Vorteile ein solches geschlossenes Design für die Lageranbringung birgt:
Geometrie: Nichts muss verstiftet und verschraubt werden. Die Bohrungen für die Fadenaufhängung und den unteren Magneten der Dämfung haben eine feste und unverrückbare Position zueinander.
Resonanzen: Gegenüber frei schwebenden Alu-Plättchen, bietet ein aus dem Vollem gearbeitetes geschlossene Form ein vielfach höhere Steifigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber angreifenden Schwingungen. Das Fadenlager wird es danken.
Design: Hinsichtlich der äusseren Formgebung hat man nahezu alle Freiheiten. Lediglich die sich gegenüberliegenden Magnete benötigen ihren festen Platz. Im weiteren darf die notwendige Bewegungsfreiheit des Tonarms nicht eingeschränkt werden.
Flexibilität: Je nach Ausführung der Anbindung an die Plattenspieler-Basis oder den Tonarmausleger, lässt sich bespielsweise der VTA (Vertical Tracking Angle) einfach über ein vertikales "Verschieben" des gesamten Bauteils erzielen ohne an den restlichen Geometrien etwas verändern zu müssen.
Bild 2 zeigt das Massnehmen am Rega-Tonarm-Lift, der letztlich gegenüber dem von Phonotools den Vorzug erhielt und dessen Verbaubarkeit bei der Konstruktion berücksichtigt werden muss.